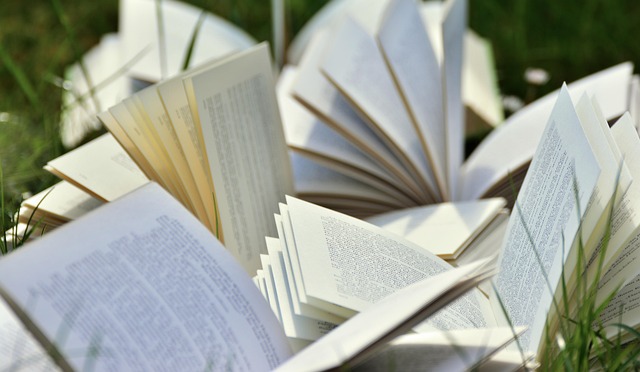Je genauer man hinsieht, desto mehr Abgründe entdeckt man: Selten traf dies so zu wie auf die fragwürdige Dissertation von Robert Habeck. Habeck hat auf geradezu unglaubliche Weise eine Belesenheit vorgetäuscht, die er nicht hat. Er hat dutzende Werke, die er zitiert hat, aus anderen, an Ort und Stelle ungenannten Quellen abgeschrieben und damit gegen eine wichtige Grundregel der Buchwissenschaften verstoßen. Er hat direkte Zitate mitplagiiert, und vor allem: Er hat auch Fließtext plagiiert. Eine Bestätigung eines Plagiierten, des deutschen Philosophen Günter Wohlfart, liegt vor.
Was wird geschehen? Wir kennen das Spiel bereits von Föderl-Schmid und anderen Plagiatoren: Da Habeck ein (Links-)Grüner ist, wird man sagen, dass der Plagiatsvorwurf unzutreffend sei. Oder dass das Abschreiben von Primärquellen aus an Ort und Stelle ungenannten Sekundärquellen in der Literaturwissenschaft ganz normal sei oder zumindest vor 25 Jahren Usus gewesen sei. Oder dass es eben in Dissertationen ganz normal sei. – Wer wird denn schon Hölderlin oder Novalis im Original lesen, als Literaturwissenschaftler?
Liegt am Ende ein Grundlagenproblem der Literaturwissenschaft vor? Wird sich das Fach dazu äußern?
Dazu ein kurzer juristischer Exkurs:
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf stellte anlässlich der rechtmäßigen Aberkennung des Doktorgrades von Annette Schavan fest:
„Maßgeblich ist insoweit ausschließlich, ob und inwieweit die der Sekundärliteratur entnommenen Paraphrasen, die sich zu den Primärquellen verhalten, als solche kenntlich gemacht worden sind. Fehlt es, wie hier, an einer solchen Kenntlichmachung und bezieht sich die Klägerin auf eine Primärquelle, deren Inhalt und/oder Deutung sie letztlich aus einer nicht nachgewiesenen Sekundärquelle abschreibt, täuscht sie. Dabei muss der Rückgriff auf Sekundärliteratur auch nicht lediglich im Grundsatz offen gelegt werden, sondern immer, also in jedem Einzelfall, in dem Sekundärliteratur gedanklich bzw. sinngemäß oder wörtlich übernommen wird. Unerheblich ist daher auch, ob und gegebenenfalls inwieweit sich eine von der Klägerin verwendete Textaussage bereits aus der angegebenen Primärquelle erschließt. Entscheidend ist lediglich, dass sie Passagen wörtlich oder leicht abgewandelt ohne entsprechenden Nachweis der ‚Zwischenquelle‘ übernommen hat, ohne diese Fremdleistung erkennbar zu machen.“ (Hervorhebungen S.W.)
Und schließlich ein Wort zum stets doofen Einwand: „Wir publizieren das vor den Wahlen – also kann der Vorwurf nicht stimmen.“ Die Wahrheit ist: Wir kriegen maximal vor den Wahlen Aufmerksamkeit für das immer gleiche Problem bei Qualifikationsschriften. Und mit der Habeck-Investigation hatten mein Team und ich nachweislich längst begonnen, als die Neuwahlen beschlossen wurden.
Wir haben diesmal ganz genau hingesehen. Hier ist unsere bislang komplexeste und im Detail entlarvende Dokumentation, zum Downloaden (188 Seiten, 27 MB) und identisch im Folgenden im Blog.
PS: Habeck fand nach langem Rumdrücken die Plagiate seiner Kollegin Baerbock „nicht gut“. Jetzt finden wir seine Diss gar nicht gut…
PPS: Und auch Habecks Ex-Staatssekretär Patrick Graichen hat in seiner Dissertation plagiiert und dafür sogar eine Rüge seiner Universität kassiert.
Plagiatsverdacht: Die systematisch verfehlte Quellenarbeit des Robert Habeck